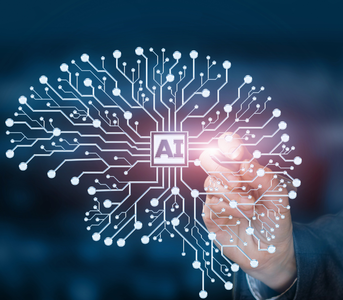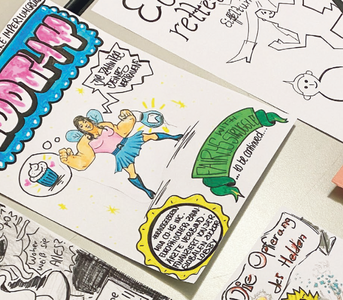Zuhören, verstehen und klare Position beziehen
Themenschwerpunkt beschäftigt sich mit selten gewordener Fähigkeit
Gast Autor*in |
Bildungszentrum, Planetarium, Stadtbibliothek
Die Demokratie und ihre Prinzipien geraten zunehmend in Gefahr. Auch, weil wir kaum mehr konstruktiv miteinander sprechen. Über den Wert des Zuhörens für die Demokratie:
Es ist etwas ins Rutschen geraten in Deutschland. Langsam, aber stetig hat sich die öffentliche Debatte in den vergangenen Jahren verändert. Sie ist härter geworden im Ton, bisweilen hoch emotional, atemberaubend schnelllebig. Zudem scheint es verzichtbar geworden zu sein, die eigene Meinung wirkungsvoll mit Fakten untermauern zu können. Stattdessen erleben wir einen segregierten Diskurs, der, vor allem in den sozialen Netzwerken, nur noch selten miteinander, dafür aber umso erbarmungsloser gegeneinander geführt wird.
Algorithmen bestärken uns unablässig in unserem Weltbild, zeigen uns das, was wir ohnehin zu wissen glauben, und schon bald mit erschreckender Zweifelsfreiheit für die Realität halten. Wer überzeugt ist, dass Impfungen krank machen, findet auf X oder Telegram viele Menschen, die das genauso sehen. Ebenso, wer Deutschland nicht für einen Staat, sondern eine GmbH hält. Die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum stellt dazu fest: „In vielen Demokratien gibt es heute keine gemeinsame Debatte mehr, von einer gemeinsamen Erzählung ganz zu schweigen. Menschen hatten immer unterschiedliche Ansichten. Heute haben sie unterschiedliche Tatsachen.“ Ihr Kollege Timothy Snyder beobachtet gar eine „offene Feindseligkeit gegenüber der verifizierbaren Wirklichkeit“.

Die weitreichende Verlagerung politischer und gesellschaftlicher Debatten in virtuelle Räume hat zur Koexistenz verschiedener Filterblasen geführt, geschlossenen Informationsuniversen also, deren Protagonisten nur noch selten über die eigene Gruppe hinaus miteinander interagieren. Und wenn sie es doch einmal tun, etwa in den Kommentarspalten der sozialen Medien, dann stets konfrontativ,
unversöhnlich, polemisch oder beleidigend. Damit droht etwas verlorenzugehen, was essenziell ist für den Fortbestand der Demokratie: der Wille und die Fähigkeit, einander zuzuhören.
Genau hier setzt die Kampagne „Hören“ des Bildungscampus Nürnberg an. Sie beleuchtet das Thema „Hören“ ganzheitlich. Ein Teilaspekt ist das gegenseitige Zuhören. So will die Reihe die Demokratie stärken, indem sie Menschen wieder ins Gespräch bringt – auch über kontroverse und emotionale Themen. Im Rahmen der Kampagne findet am 19. Oktober 2025 die Veranstaltung „Ins Gespräch kommen! Wie man erfolgreiche politische Diskussionen führt“ statt. Referent ist Peter Correll, Politikwissenschaftler und seit über zehn Jahren in der politischen Bildung aktiv. Gemeinsam mit den Teilnehmenden erarbeitet er, wie konstruktive Auseinandersetzungen gelingen können: zuhören, streiten, klare Positionen gegen populistische Aussagen beziehen – aber auch den „kleinen Populisten“ in uns selbst wahrnehmen.

Wie sehr die Demokratie unter Druck ist, zeigen wissenschaftliche Erhebungen immer wieder. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung im Jahr 2024 gaben 51 Prozent der Befragten an, ihr Vertrauen in die Demokratie sei „weniger groß“ oder „gering“. In einzelnen Regionen sind die Ergebnisse sogar noch alarmierender. Im Sachsen-Monitor 2023 zeigten sich 59 Prozent der Befragten „eher unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“ mit der Demokratie in Deutschland. Nun ist diese Missstimmung gewiss nicht monokausal zu erklären, die Gründe für Wut und Vertrauensverlust sind vielfältig und entziehen sich holzschnittartigen Zuschreibungen.
Dass es dem gesellschaftlichen Frieden nutzen würde, wieder stärker aufeinander zuzugehen, den Beobachtungen, Perspektiven und Erfahrungen anderer zumindest einmal Gehör zu schenken, ist allerdings sehr wahrscheinlich. Ebenso hilfreich wäre es, den Gedanken zuzulassen, dass das Gegenüber mit seinen Argumenten vielleicht sogar recht haben könnte. Einander aushalten, miteinander sprechen, Kompromisse schließen und: zuhören – das ist Teil des Wesenskerns demokratischer Gesellschaften.
Weil nur so ein Dialog entsteht, der über einen bloßen Schlagabtausch hinausgeht. Weil es Frustration, Polarisierung und Radikalisierung entgegenwirkt. Weil politische Entscheidungen an Qualität gewinnen, wenn verschiedene Argumente und Sichtweisen einfließen können. Weil ein respektvoller Dialog die Legitimität und Akzeptanz demokratischer Beschlüsse erhöht. Weil es verhindert, dass mächtige Akteure ihre Partikularinteressen unwidersprochen durchsetzen können. Und nicht zuletzt, weil eine breite gesellschaftliche Debatte auch Minderheiten zu Wort kommen lässt. Deren Interessen und Rechte immer mit abzuwägen, ist unverzichtbar. Demokratie darf nicht als eine Diktatur der Mehrheit fehlinterpretiert werden.

Die Aufforderung zum offenen Austausch von Argumenten und Gedanken darf sich selbstverständlich nicht nur an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger richten. Sie betrifft alle gesellschaftlichen Akteure: Vereine, Verbände, Kirchen, Unternehmen, Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen, kulturelle Institutionen und viele mehr. Und natürlich die Amts- und Mandatsträger in der Politik. Die Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey bilanzieren nach Gesprächen mit Anhängern der Querdenken-Bewegung: „Natürlich muss die Politik am Ende bindende Entscheidungen treffen, sie kann aber […] stärker die Alternativen offenlegen und so den Bürger:innen die jeweiligen Konsequenzen erläutern, statt sich auf Sachzwänge zu berufen.“ Also: die öffentliche Diskussion aktiv führen, sie bewusst suchen, sie nicht unter Verweis auf die angebliche Unvermeidbarkeit einer in Rede stehenden Reform oder Maßnahme ersticken. Und bloß keinen moralischen Allgemeinvertretungsanspruch formulieren.
Doch so wichtig der Dialog und das gegenseitige Zuhören auch sind – es gibt Grenzen. Nicht jede noch so abseitige Position, nicht jedes menschenfeindliche Gebrüll verdient Aufmerksamkeit. Wer etwa den Holocaust leugnet, offen Rassismus propagiert, sich gegen die Werte des Grundgesetzes wendet oder zu Gewalt aufruft, der wird vom Mitgestalter der Demokratie zu ihrem Gegner – und kann nicht länger Teil einer zivilisierten, lösungsorientierten Debatte sein.
Wie gut es jedoch gelingen kann, konstruktiv miteinander zu sprechen, zeigt eine Studie, die ein internationales Forschungskonsortium im Jahr 2015 durchgeführt hat. Daran beteiligt war auch der deutsche Soziologe Steffen Mau. Er und seine Kollegen luden 35 Personen, die die Gesellschaft in ihrer Breite abbilden sollten, nach Berlin ein und ließen sie miteinander diskutieren – über Steuern, Gerechtigkeit und Sozialpolitik. Der achtstündigen Sitzung folgte bald darauf eine zweite, die Teilnehmenden erhielten zudem einige Informationen, Daten und Fakten zu den jeweiligen Themenbereichen.
„Obwohl die Teilnehmer aus allen Schichten kamen und auch in ihren Einstellungen sehr divers waren, gelang es ihnen, am Ende Positionen zu formulieren, die sich in der Breite der Gruppe als zustimmungsfähig erwiesen“, schreibt Mau zum Ausgang des Experiments. Gleichzeitig habe sich gezeigt, dass sich radikale Positionen einhegen und abschwächen ließen. Zuhören, Diskutieren, Streiten und Abwägen lohnt sich also offenbar. Respekt, Einigungswillen und Offenheit vorausgesetzt. Reden wir also miteinander statt übereinander.
Alle Veranstaltungen der Reihe „Hören“ und weitere Infos unter nuernberg.de/internet/stadtbibliothek/hoeren.html.
Text: Dominik Mayer